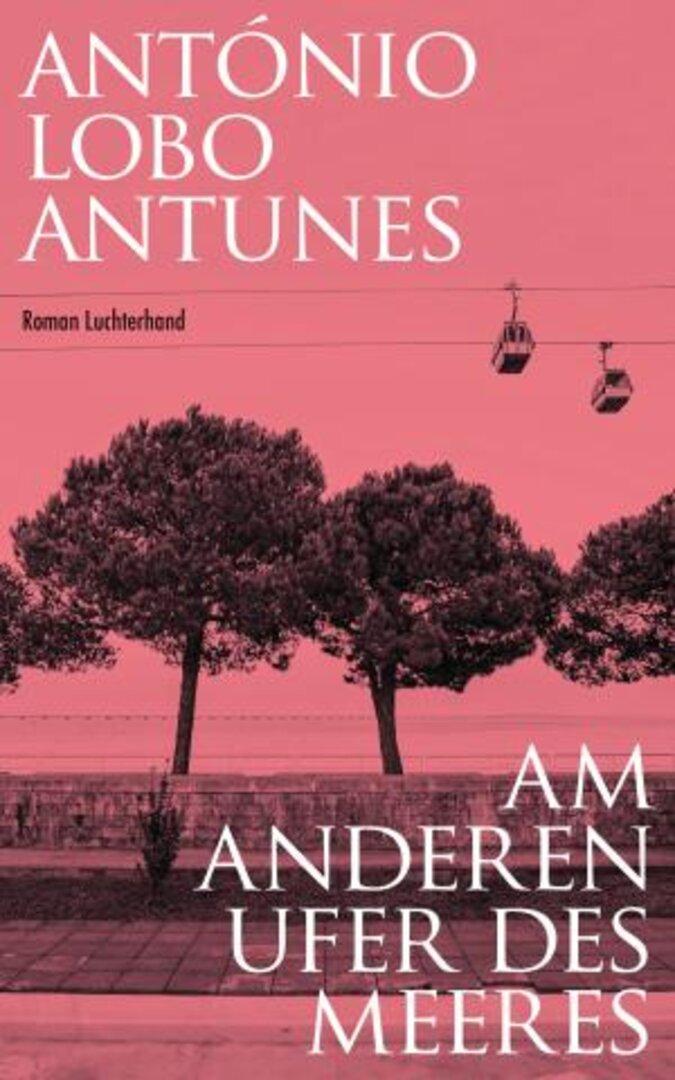
António Lobo Antunes ist wieder bei den Schrecken des Kolonialkriegs in Angola. Und bei den Fledermäusen in den Mangobäumen
Es ist sein Lebensthema. Das portugiesische Trauma vom Kolonialkrieg in Angola.
Ein Blick ins Archiv. Als auf Österreichs Bestsellerlisten Patrick Süßkind, Alois Brandstetter oder Gabriel García Márquez dominierten, also Mitte der 1980er, schrieb António Lobo Antunes bereits über portugiesische Kolonialverbrechen in Afrika. Schon damals wurde der heute 84-Jährige als Anwärter für den Nobelpreis gehandelt. Ebenso wie sein inzwischen verstorbener Landsmann José Saramago oder der geheimnisumwitterte Amerikaner Thomas Pynchon, von dem neuerdings ein aktuell wirkendes Foto im Internet kursiert (natürlich eine Fälschung).
Nur einer von ihnen -Saramago – hat den Nobelpreis bekommen. António Lobo Antunes hat mittlerweile bekannt gegeben, dass er darauf „scheißt“ – schließlich würden Preise Bücher „auch nicht besser machen“. So wenig entgegenkommend der (unterdessen anderwärtig ausgezeichnete) Schriftsteller sich in seinem Auftreten gibt, so wenig zugänglich ist mitunter auch sein Schreiben. Und umso faszinierender.
António Lobo Antunes hat an die vierzig Bücher veröffentlicht, ums reine Geschichtenerzählen geht es ihm dabei weniger als um das „Leben zwischen zwei Buchdeckeln“, wie er in Interviews sagte. Auch „Am anderen Ufer des Meeres“ ist eher ein Buch der Momentaufnahmen, der einprägsamen Bilder und der starken Atmosphären. Es ist gut, von vornherein zu wissen, warum es hier grundsätzlich geht, um sich in diesem sprachlich überbordenden Universum zurechtzufinden.
Hintergrund sind die Arbeiterproteste, die 1960 in den Baumwollplantagen in Baixa do Cassanje in Angola begannen und bald darauf vom portugiesischen Militär niedergeschlagen wurden. Die Portugiesen zerstörten dabei siebzehn Dörfer, auch Napalm soll eingesetzt worden sein. Der Aufstand gilt als Auslöser für den bis 1974 dauernden Krieg Portugals gegen die Befreiungsbewegungen der damals „Überseeprovinz“ genannten Kolonie Angola. António Lobo Antunes, geboren 1942 in Lissabon, wurde 1970 zwangsverpflichtet und der Krieg zu seinem Lebensthema.
Lebendig begraben
In inneren Monologen blicken hier ein Soldat, ein Verwalter und die Tochter eines Plantagenbesitzers zurück auf die Ereignisse. Letztere berichtet vom Vater, der ihr untersagt, Kimbundu zu sprechen, „das Gegurgel der Pretos“. Die „Pretos“, die Schwarzen, deren Alter man nicht erkennen könne, weil sie doch alle gleich aussähen, aber „immerhin klüger als Hunde“ wären. Sie erzählt von Söldnern, die eine Frau lebendig vor ihrer Hütte begraben, „die gebrochenen Arme und Beine um den Körper gewickelt und ihre Augen offen, während sie Erde auf sie warfen“. Zu den Bildern des Grauens gesellen sich jene der kreischenden Fledermäuse in den Mangobäumen und der unter einem uniform-farbenen Himmel über den Feldern kreisenden Milane. „Wie ist eigentlich Angola?“, wird man sie später fragen. Sie wird sich an die Antilopen und die gelbäugigen Mandrille erinnern, an die Wahrsager und Hexer und an die Leprakranken am Fluss.
Im Anhang befindet sich ein Glossar für die vielen lokalen Ausdrücke. Auch der oft erwähnte Aufständische António Mariano wird hier erklärt. Übersetzerin Maralde Meyer-Minnemann hat, um der Schönheit des Textes willen, vieles im Original belassen. Man wird trotz Glossar nicht alles verstehen. Auch gut. Lieber den Fledermäusen in den Mangobäumen lauschen.
Cover
António Lobo Antunes:
„Am anderen Ufer des
Meeres“
Luchterhand. 448 S. 27,50 €
Source:: Kurier.at – Kultur



