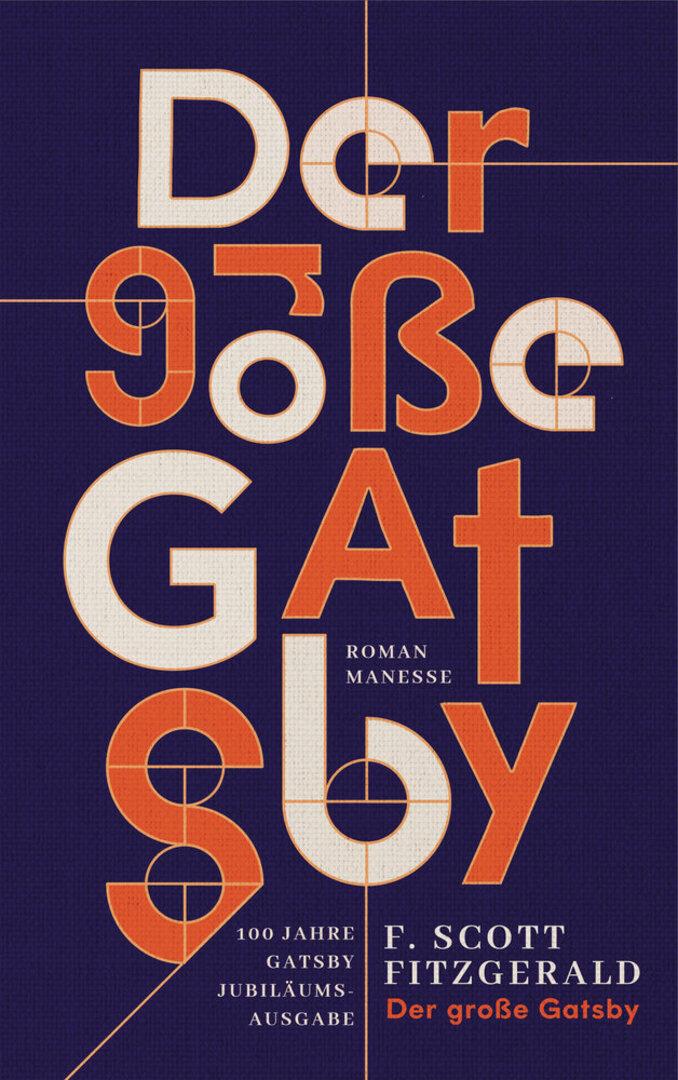
„Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald erschien erstmals am 10. April 1925. Über die Höhen und Tiefen, die dieser Roman in hundert Jahren erlebte
F. Scott Fitzgerald hatte sein letztes Exemplar von „Der große Gatsby“ verliehen, deswegen konnte er Ernest Hemingway, den er kurz zuvor in einer Pariser Bar kennengelernt hatte, nur davon erzählen. Er äußerte sich zurückhaltend und berichtete, es verkaufe sich nicht sehr gut. Immerhin habe es einige gute Besprechungen erhalten.
Der damals 26-jährige Hemingway hielt den nur drei Jahre früher Geborenen für einen „viel älteren“, aber keineswegs ernsthaften Schriftsteller, insbesondere, weil dieser auch Kurzgeschichten für Zeitungen schrieb – für Hemingway eine „Hurerei“. Die Lektüre des „Gatsby“ änderte Hemingways Sichtweise auf den Mann und den Schriftsteller. Er hielt den Roman für nicht weniger als „großartig“ und glaubte, darin auch viel über die Persönlichkeit seines Autors zu erkennen.
Nicht alle Rezensenten der 1920er-Jahre hatten Hemingways Weitblick in Bezug auf diesen epochenprägenden Roman. Er wurde durchwachsen aufgenommen.
Francis Scott Fitzgerald, geboren 1896 in Minnesota, hatte, als das Buch am 10. April 1925 beim New Yorker Verlag Scribner’s erschien, bereits zwei Romane veröffentlicht. Er galt als vielversprechend, aber ungeschliffen und war überzeugt, dass sein Werk vergessen werden würde. Ein Irrtum. Insbesondere „Der große Gatsby“ wurde ein Klassiker, der auch Hundert Jahre und einige mehr oder weniger gelungene Verfilmungen später, nach einem schleppenden Beginn, immer noch ein „Longseller“, ein Dauerbrenner, für die Verlage ist.
Ein Erzähler namens Nick Carraway, ein mittelloser Intellektueller, berichtet darin von seinem faszinierenden, dubiosen Nachbarn. Jay Gatsby ist Kriegsveteran und ein Neureicher, der auf seinem palastartigen Anwesen in Long Island schillernde, sinnlose Feste feiert, selbst aber die Gesellschaft meidet. Gatsby bleibt einsam, weil er sich nach Nicks verheirateter Cousine Daisy, seiner großen, verlorenen Jugendliebe sehnt.
Woher sein Reichtum stammt, ist nicht klar, sicher ist, dass seine Erzählungen nicht stimmen. Er wird letztlich zur tragischen Figur, ein Prototyp des Blenders der Goldenen Zwanziger, die bekanntlich finster endeten.
Die Gegensätze zwischen New York City und der reichen Ostküstengesellschaft sind bestimmende Themen des Romans, darüber hinaus hat das ganze auch einen mystischen Touch: Immer wieder ist die Rede von einem anziehenden „grünen Licht“.
„Er wird auch einen katholischen Einschlag haben“, schrieb Fitzgerald seinem Lektor Maxwell Perkins im August 1924 über seinen Roman, und er fühlte selbst, dass er an etwas Großem dran war: „Mein Roman wird der beste amerikanische Roman sein, der je geschrieben wurde.“ Seine Titelvorschläge war schon weniger zukunftsweisend: „Goldhütiger Gatsby“ oder, schlimmer: „Trimalchio in West Egg“ schwebten ihm vor. Perkins wusste dennoch sofort, dass er mit dem Roman ein „Wunderwerk“ in Händen hielt und schlug einen vernünftigeren Titel vor. Nachzulesen ist der stellenweise sehr launige Briefwechsel in Bernhard Robbens nun erschienener kommentierter Jubiläumsausgabe samt Nachwort des Publizisten Claudius Seidl.
Wirklich umfassend gewürdigt, schreibt Seidl, wurde der Roman erst nach dem Tod seines Autors im Jahr 1940, „nachdem der Börsenkrach und die große Depression die brüllenden Zwanziger, wie man sie in Amerika nannte, zur verstummten, weitgehend abgeschlossenen und vielleicht schon wieder herbeigesehnten Vergangenheit gemacht hatten“.
Cover
F. Scott Fitzgerald: Der große Gatsby. Manesse
Übersetzung: Bernhard Robben
352 S. 31,50 €
Source:: Kurier.at – Kultur



