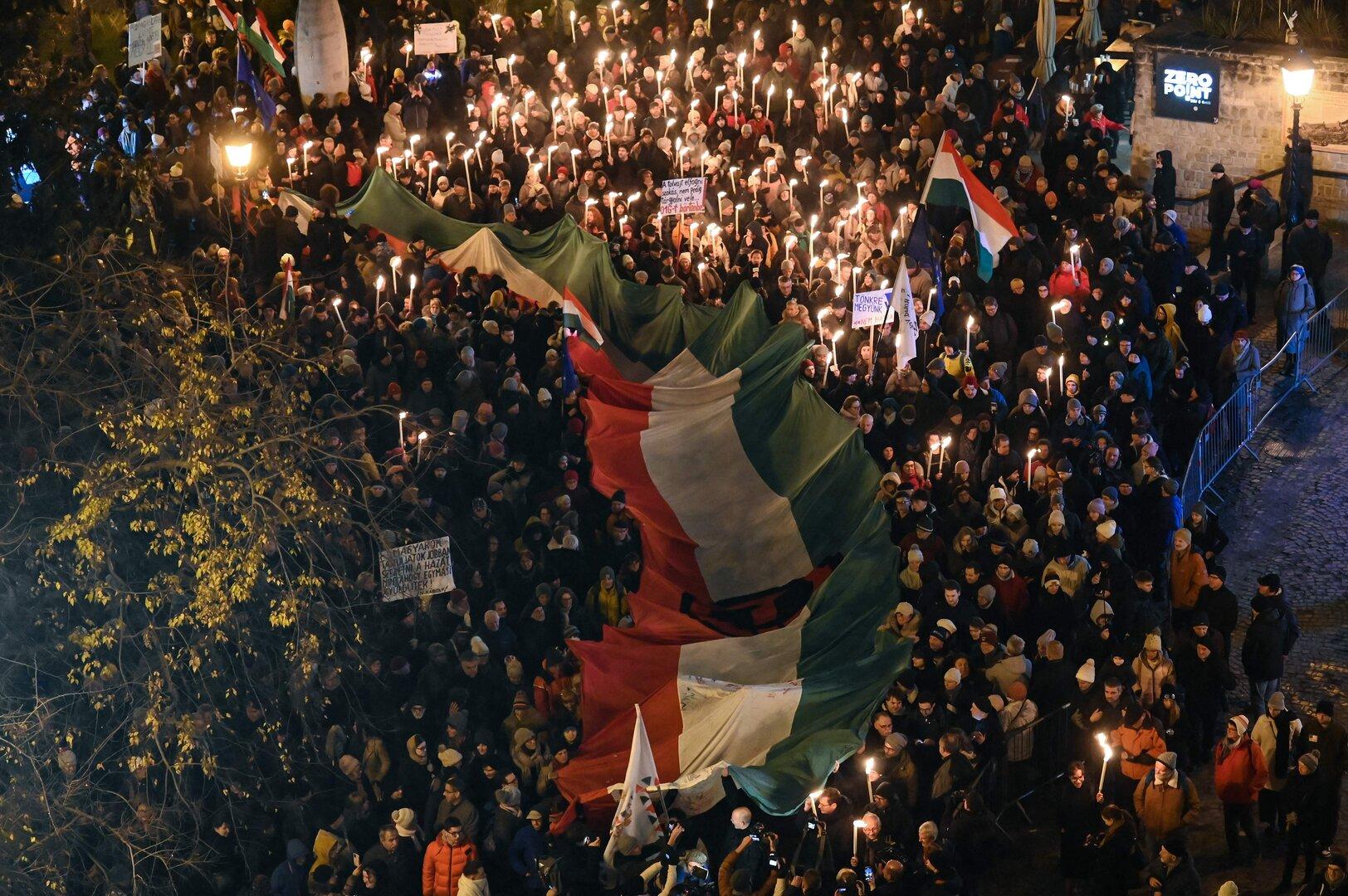
„Die Wahl im nächsten Jahr wird die letzte vor dem Krieg sein.“ Die anderen europäischen Staats- und Regierungschefs, sie hätten längst entschieden, Europa in einen Krieg zu führen. Es ist Anfang Dezember, der ungarische Ministerpräsident sitzt in blauem Hemd, leger ohne Krawatte, auf einer Bühne in einer Sporthalle im zentralungarischen Kecskemét, vor seinen Anhängern. Im Wahlkampf, in dem sich Ungarn gerade befindet, wird die drohende Kriegsgefahr noch häufiger beschworen als sonst.
Das Paradoxe dabei: Während die meisten anderen europäischen Länder den Wehrdienst wieder einführen und ihr Militär aufstocken, ist das Thema in Ungarn trotz der ständigen Warnungen vor einem Krieg absolut tabu. Die vermeintliche Kriegsgefahr dient Viktor Orbán vorrangig als populistische Rhetorik, um die Bevölkerung emotionsgetrieben hinter sich zu scharen. Gleichzeitig weiß er, der in den vergangenen Jahren unauffällig die Militärausgaben erhöht, Ungarn einst in die NATO geführt hat und ursprünglich gegen die Abschaffung der Wehrpflicht gewesen ist, ganz genau, dass er mit dem Thema Wehrdienst auch bei seinen eigenen Wählern unten durch wäre. Obwohl die Ungarn das Thema Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit laut Eurobarometer-Umfrage als die wichtigsten Aufgaben von Regierung und EU sehen.
Die Einstellung der ungarischen Bevölkerung zum Militär zeigt beispielhaft, was sie von ihrem Staat verlangt – nämlich einiges – und wie viel sie bereit ist, dafür zu geben – nämlich wenig.
Balazs Trencsenyi ist Historiker an der Central European University (CEU), jene von George Soros finanzierte Universität, die Orbán vor einigen Jahren per Gesetz aus Ungarn gedrängt hat. Trencsenyi forscht zu politischem und kulturellem Denken in Ungarn und Ostmitteleuropa, und sagt verkürzt: Die Unwilligkeit der Ungarn, Zeit oder Geld in Form von Militärdienst oder Steuern an Gesellschaft oder Staat zu leisten, wurzelt in einer stillschweigend zwischen Bevölkerung und kommunistischer Regierung getroffenen Vereinbarung: Lässt du mich in Ruh, dann lass ich dich in Ruh.
Der Staatsapparat war stets auf eine starke Führungsperson ausgerichtet, das Vertrauen in Institutionen nie groß.
Balazs Trencsenyi / Central European University
Der Staat schaute weg
„Nach dem Aufstand 1956 gegen die Sowjetunion hat der kommunistische Staat erkannt, dass die Androhung von Terror und Repression als Wirtschaftsstimulation nicht mehr funktioniert. Stattdessen wurden Lockerungen hingenommen und der Bevölkerung ermöglicht, bescheidenen, privatwirtschaftlichen Handel zu betreiben“, sagt Trencsenyi. Der sogenannte „Gulaschkommunismus“ war geboren.
Bauern durften einen Teil der Felder, für die sie zuständig waren, selbst bestellen und die Ernte verkaufen; Fabrikarbeiter nach ihrer Schicht für den privaten Verkauf produzieren – sodass viele Arbeiter während ihrer eigentlichen Arbeitszeit ihre Produktivität zurückfuhren, ihren Lohn erhielten sie schließlich trotzdem. Die Folge: „Eine Schwächung des Staatsapparats und ein ausbleibendes Wirtschaftswachstum, während der Normalbürger das Gefühl hatte, dass Staat und Leben funktionierten und gut waren.“
Die Ungarn waren stolz auf ihre Art des Überlebens. Im Vergleich zu anderen sozialistischen Ländern wie der DDR oder der Tschechoslowakei war das Wohlstandsniveau in Ungarn in den 60er- und 70er-Jahren höher, sagt Trencsenyi. Das lässt sich auch an den steigenden Fällen von Herzkrankheiten ablesen, zurückzuführen auf den höheren Konsum von Fleisch: Mit höherem Einkommen konnte man sich die Kuh oder das Schwein am Teller täglich leisten.
In Ungarn sorgten diese „Freiheiten“ im Vergleich zum repressiven Stalinismus für …read more
Source:: Kurier.at – Politik



